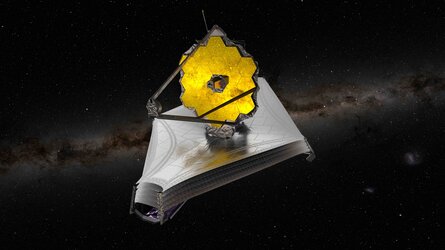Seeungeheuer gibt es doch: ESA-Radarsatelliten entdecken „Monsterwellen“
Einst als Seemannsgarn abgetan, werden sie inzwischen als Hauptursache für den ungeklärten Untergang vieler Ozeanriesen gehandelt: gigantische Riesenwellen, die mitunter die Höhe eines zehnstöckigen Hochhauses erreichen können. Dass diese „Monsterwellen“ tatsächlich häufiger vorkommen als gedacht, hat jetzt Datenmaterial von den ERS-Satelliten der ESA bewiesen. Von der Auswertung erhofft man sich nun nähere Erkenntnisse über den Ursprung dieses mysteriösen Phänomens.
In den letzten zwanzig Jahren sind mehr als 200 Supertanker und Containerschiffe von mehr als 200 Meter Länge auf hoher See untergegangen – meist unter schweren Wetterbedingungen. Inzwischen glaubt man, dass Riesenwellen, so genannte „Freak Waves“, für einen Großteil dieser Unglücksfälle verantwortlich sind.
Die Schilderungen von Seeleuten, die eine solche Begegnung erlebt haben, hören sich schier unglaublich an. So traf beispielsweise das Kreuzfahrtschiff Queen Elizabeth II im Februar 1995 während eines Hurrikans im Nordatlantik auf ein 29 Meter hohes Wellenungetüm. Kapitän Ronald Warwick erinnert sich an „eine einzige riesige Wasserwand... es sah aus, als steuerten wir auf die weißen Klippen von Dover zu.“
Im Südatlantik traf es Ende Februar 2001 binnen einer Woche gleich zwei andere Kreuzfahrtschiffe, die Bremen und die Caledonian Star. In beiden Fällen durchschlugen Riesenwellen die Fenster der Kommandobrücke, die immerhin 30 Meter über der Wasseroberfläche liegt. Die Bremen trieb daraufhin zwei Stunden lang antriebslos und ohne Navigationssysteme auf hoher See.

„Die beiden Vorfälle ereigneten sich weniger als 1000 Kilometer voneinander entfernt“, erklärt Dr. Wolfgang Rosenthal, Wissenschaftler am GKSS Forschungszentrum in Geesthacht, der das Phänomen Riesenwellen schon seit Jahren erforscht. „Bei der Bremen fiel die komplette Elektronik aus, während sie parallel zu den Wellen im Wasser trieb. Während des Ausfalls dachte die Mannschaft schon, dass vielleicht ihr letztes Stündlein geschlagen haben könnte.“
„Genau das gleiche Phänomen ist vielleicht für den Untergang vieler Schiffe verantwortlich, die nicht so viel Glück hatten. Im Durchschnitt sinken jede Woche zwei große Schiffe. Aber die Ursachen werden nie so gründlich untersucht wie zum Beispiel bei einem Flugzeugabsturz – es heißt dann immer nur ‚schlechtes Wetter’.“
Auch Bohrinseln sind nicht vor den Monsterwellen sicher. Am 1. Januar 1995 wurde die Nordsee-Bohrinsel Draupner von einer „Freak Wave“ getroffen – ein Lasermessgerät an Bord gab die Höhe mit 26 Metern an. Die Wellen in der Umgebung des Ungetüms waren mit bis zu 12 Metern nicht minder beeindruckend.

Angesichts verlässlicher Radaraufzeichnungen von Plattformen wie der Draupner zeigen sich inzwischen auch ehemals skeptische Wissenschaftler überzeugt. Ihre bisherigen Statistiken gingen davon aus, dass derartige Abweichungen vom normalen Wellengang nur einmal alle 10.000 Jahre vorkommen können. Radardaten aus dem Nordsee-Ölfeld Goma belegen jedoch 466 solcher Vorkommnisse allein in 12 Jahren.
Die Einsicht, dass Riesenwellen viel häufiger auftreten als bisher gedacht, hat drastische Auswirkungen auf die Sicherheitskonzepte für die Ozeanriesen und Bohrplattformen. Denn aktuell sind sie in der Regel nur für Wellen bis maximal 15 Meter Höhe ausgelegt – zu wenig, wie man inzwischen weiß.
Die Europäische Union hatte bereits im Dezember 2000 erkannt, dass Handlungsbedarf besteht: Mit MaxWave brachte sie ein Projekt zur Erforschung der Riesenwellen auf den Weg. Es sollte Art und Umfang ihres Auftretens bestätigen, ihre Entstehung nachvollziehen und natürlich feststellen, welche Auswirkungen all diese Tatsachen auf die Konstruktionskriterien für Schiffe und maritime Bauwerke wie Bohrinseln haben. Pionierarbeit leisteten dabei die ERS-Radarsatelliten der ESA: Anhand der von ihnen übermittelten Daten nahm man im ersten Schritt eine Bestandsaufnahme der weltweiten Wellenszene vor.

„Ohne die Radaraufnahmen aus der Luft hätten wir überhaupt keine Chance gehabt, irgendwelche neuen Erkenntnisse zu gewinnen“, erklärt Rosenthal, der das auf drei Jahre angesetzte MaxWave-Projekt leitete. „Beim Projektstart konnten wir für unsere Arbeit lediglich auf Radardaten von Bohrinseln zurückgreifen. Also waren wir von Anfang an daran interessiert, die ERS-Satelliten für unsere Zwecke zu nutzen.“
Die ERS-Zwillingssatelliten der ESA, ERS-1 und ERS-2, drehen seit Juli 1991 bzw. April 1995 ihre Bahnen um die Erde - und werden bei ESA/ESOC in Darmstadt kontrolliert. An Bord führen sie jeweils ein so genanntes SAR (Synthetic Aperture Radar), mit dem sie ihre Daten sammeln.
Das SAR wiederum arbeitet in verschiedenen Modi. Über dem Ozean kommt der Wellenmodus zum Einsatz, bei dem in Abständen von 200 Kilometern kleine „Ozeanausschnitte“ mit einer Größe von 10 auf 5 km aufgenommen werden.

Jeder dieser Ausschnitte wird anschließend auf mathematischem Wege in eine Aufstellung der durchschnittlichen Wellenenergie und -richtung aufgeschlüsselt, ein so genanntes Ozeanwellenspektrum. Diese Spektren stellt die ESA zum öffentlichen Abruf bereit. Meteorologen verwenden sie beispielsweise, um genauere Modelle für die Seewettervorhersage zu entwickeln.
„Die Rohbilddaten werden in der Regel nicht zur Verfügung gestellt, aber wir dachten uns, dass sie mit ihrer hohen Auflösung von zehn Metern auch im Urzustand schon eine Unmenge von Informationen enthalten sollten“, so Rosenthal weiter. „Die Wellenspektren liefern uns zwar Durchschnittsdaten zum Wellengang, aber aus den Rohdaten können wir zusätzlich die Höhe der einzelnen Wellen erkennen – darunter natürlich auch genau die Extreme, für die wir uns so interessieren.“
„Die ESA hat uns mit drei Wochen an Datenmaterial versorgt, insgesamt gut 30.000 einzelne Bildausschnitte, allesamt aus dem Zeitraum, als die Bremen und die Caledonian Star getroffen wurden. Im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR haben wir die Bilder dann verarbeitet und automatisch nach extremen Wellenhöhen durchsuchen lassen.“

Trotz des relativ kurzen Erfassungszeitraums waren die Ergebnisse beeindruckend: Das MaxWave-Team konnte mehr als zehn Riesenwellen von über 25 Meter Höhe ausfindig machen, deren Auftreten über den gesamten Erdball verteilt war.
„Wir haben damit bewiesen, dass es sie gibt, und zwar deutlich öfter als bisher vermutet. Im nächsten Schritt wollen wir nun analysieren, ob sie sich auch vorhersagen lassen”, fasst Rosenthal den aktuellen Stand der Dinge zusammen. „Das MaxWave-Projekt ist zwar Ende letzten Jahres offiziell zu Ende gegangen, an zwei Arbeitsfeldern wird allerdings weitergeforscht. Zum einen werden die Ursachen von Schiffsuntergängen untersucht, um davon ausgehend die Sicherheit von Schiffen zu verbessern. Zum anderen werden wir noch mehr Satellitendaten analysieren und uns dabei besonders auf die Frage konzentrieren, ob Vorhersagen möglich sind.“
Die Rede ist von WaveAtlas, einem neuen Forschungsprojekt, in das ERS-Bildmaterial aus einem Zeitraum von zwei Jahren einfließen wird. Aus einer statistischen Analyse soll dabei ein Atlas entstehen, der das Auftreten von Riesenwellen auf der ganzen Welt aufzeichnet. Geleitet wird das Projekt von Susanne Lehner, Associate-Professorin für angewandte Meeresphysik an der Universität von Miami. Auch Rosenthal, mit dem Lehner schon am DLR im Rahmen von MaxWave zusammengearbeitet hat, wird bei dem neuen Projekt wieder mit von der Partie sein.
"Wenn man sich durch das Bildmaterial arbeitet, fühlt sich das fast so an, als ob man über die Wasseroberfläche fliegt. Man kann den Seegang entlang der Bahn des Satelliten ganz genau verfolgen“, erklärt Lehner die Faszination ihrer Arbeit. „Außerdem sieht man auch Sachen wie Eisschollen, Ölteppiche oder Schiffe sehr deutlich – es gibt also großes Interesse, die Daten auch zu anderen Forschungszwecken zu verwenden.“
„Nur Radarsatelliten können uns das Datenmaterial liefern, das wir für eine solide statistische Analyse der Weltmeere brauchen. Anders als normale Fotosatelliten funktionieren sie auch dann noch, wenn es dunkel oder bewölkt ist. Bei stürmischem Wetter sind sie zum Beispiel die einzige Möglichkeit, an brauchbare Daten zu kommen.“
Einige Auffälligkeiten haben die Wissenschaftler bereits gefunden. So bilden sich die Riesenwellen besonders oft dort, wo „normale“ Wellen auf Meeresströmungen und Wasserwirbel treffen. Die Strömung bündelt die Wellenenergie, sodass immer größere Wellen entstehen – Lehner vergleicht das Prinzip mit einer Linse, die Lichtenergie auf einen kleinen Punkt konzentriert.

Eine besonders ergiebige Gegend ist in dieser Hinsicht das Gebiet vor der Ostküste von Südafrika, wo der bekannt gefährliche Agulhasstrom sein Unwesen treibt. Doch auch andere große Strömungen sind potenzielle Riesenwellen-Verursacher – zum Beispiel der Golfstrom im Nordatlantik, der dort auf Wellen aus der Labradorsee trifft.
Allerdings zeigen die Daten auch, dass Riesenwellen ebenso gut in der Nähe von Wetterfronten und Tiefdruckgebieten entstehen können, weit entfernt von irgendwelchen Strömen. Ursache sind hartnäckige Stürme, die länger als 12 Stunden andauern. Wenn anhaltender Wind in so einer Situation auf eine Welle trifft, die sich gerade synchron zur Windgeschwindigkeit bewegt, kann es dazu kommen, dass sich die Welle dadurch immer weiter hochschaukelt. Dabei kommt es gerade auf die richtige Geschwindigkeit an – wäre die Welle zu schnell, würde sie dem Sturm davonziehen und sich irgendwann verlaufen, wäre sie zu langsam, würde der Sturm einfach über sie hinweg ziehen.
„Einige der Ursachen von Riesenwellen kennen wir jetzt, aber einiges liegt auch noch im Dunkeln“, so Rosenthal abschließend. Etwas Zeit bleibt noch: Das WaveAtlas-Projekt soll bis zum ersten Quartal 2005 weitergehen.















 Germany
Germany
 Austria
Austria
 Belgium
Belgium
 Denmark
Denmark
 Spain
Spain
 Estonia
Estonia
 Finland
Finland
 France
France
 Greece
Greece
 Hungary
Hungary
 Ireland
Ireland
 Italy
Italy
 Luxembourg
Luxembourg
 Norway
Norway
 The Netherlands
The Netherlands
 Poland
Poland
 Portugal
Portugal
 Czechia
Czechia
 Romania
Romania
 United Kingdom
United Kingdom
 Slovenia
Slovenia
 Sweden
Sweden
 Switzerland
Switzerland